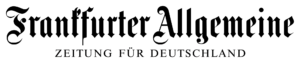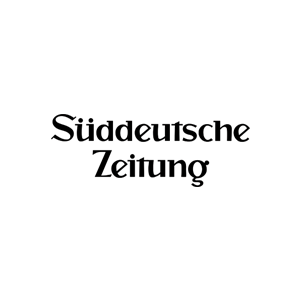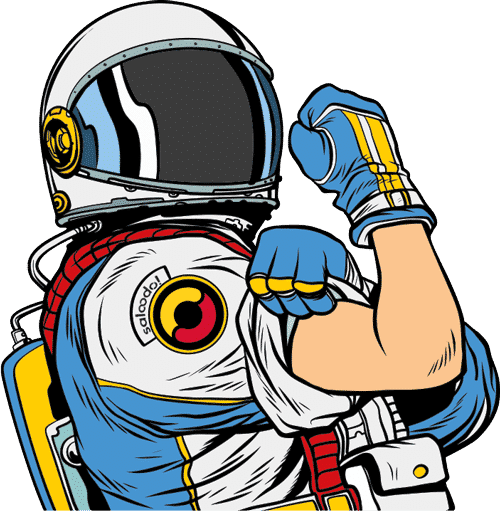Das Szenario 2030 des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur sieht eine rasch zunehmende Verzahnung von Verkehrsträgern, verbesserte Transportflüsse und eine deutlich erhöhte Transparenz von Lieferketten. Das zunehmend digitalisierte Transportmanagement wird von künstlicher Intelligenz unterstützt, sodass Fahrzeuge und Infrastruktur die Transportrouten großenteils selbst managen können.
Für die Logistik- und Transportbranche ist diese Zukunft eine gewaltige Herausforderung. Sie muss sich bewegen, denn die fortschreitende Digitalisierung der gesamten Wirtschaft bedeutet nicht weniger, als dass Speditionen und Transportunternehmen – Stichwort Logistik 4.0 in Zukunft nur noch dann mit Aufträgen rechnen können, wenn sie für die Kommunikation eine digitale Struktur bieten, die sich über entsprechende Schnittstellen in das IT-System des Auftraggebers integrieren lässt. Ohne diese Möglichkeit werden auch mittelständische Transportunternehmen und Speditionen sich nicht im Wettbewerb halten können.
Voraussetzungen schaffen
Es zeichnet sich also deutlich ab, dass Speditionen in immer weiter wachsendem Umfang logistische Dienstleistungen bewältigen müssen. Gleichzeitig müssen sie der Konkurrenz immer eine Nase voraus sein. Die Voraussetzungen dafür müssen allerdings vielerorts erst noch geschaffen werden, denn die Kommunikation zwischen Verladern und Transporteuren oder Speditionsunternehmen ist nach wie vor vielfach analog organisiert – zum Beispiel an der Verladerampe. Lieferscheine und Warenpalletten wechseln die Besitzer, Unterschriften werden in mehrfacher Ausfertigung geleistet und abgeheftet. Bei diesen Arbeitsabläufen ist von einer Digitalisierung der Lieferkette (supply chain) oft weit und breit nichts zu sehen.
Warum ist das an der Rampe so? Tatsache ist, dass der reale Übergang vom Wareneingang beziehungsweise -ausgang zum Transportfahrzeug mit allen notwendigen Informationen, Absprachen und Detailregelungen relativ vielschichtig ist. All dies ist Gegenstand der Kommunikation zwischen dem Lagermitarbeiter und dem Fahrer der ausführenden Spedition oder einem unterbeauftragten Transportunternehmen. Vieles, wenn nicht das meiste wird händisch erfasst. Natürlich gibt es dafür auch eine digitale Lösung, indem etwa die Daten eines Lagerverwaltungssystems (LVS) in ein Transport Management System (TMS) übertragen werden. Aber selbst wenn die Voraussetzungen auf beiden Seiten dafür vorhanden sind, fehlt es oft an entsprechenden Schnittstellen. Das heißt, die Systeme können untereinander nicht kommunizieren. Dann helfen nur noch Formulare und handverfertigte Listen. Klar ist aber auch, dass die Zeit darüber hinweggehen wird.
Schnittstellen für die Supply Chain
Die Schnittstellen werden zunehmend wichtig. Sie sind von zentraler Bedeutung für den gesamten Prozess der Digitalisierung. Dabei geht es keineswegs nur um so relativ kleine Probleme wie die Kommunikation und den Datenfluss an der Verladerampe. Das Ziel ist komplexer.

Es geht um die durchgehende Digitalisierung der gesamten Lieferkette, angefangen von der Materialbeschaffung und Lagerhaltung des Warenherstellers über den gesamten Prozess der Produktion bis hin zur Lagerung der Waren und schließlich ihrer Versendung über ebenfalls digital eingebundene Spedition oder ein Transportunternehmen und die Auslieferung an den Kunden. Am Ende der Entwicklung steht eine digital gesteuerte und kontrollierte, völlig papierfreie Supply Chain – schnell, effektiv, transparent. Die Logistik muss sich mit diesen weitgehend automatisierten Prozessen verknüpfen. Denn die Informationskette darf generell und besonders zwischen Büro und Fahrer dort, wo es auf Effizienz und Geschwindigkeit ankommt, nicht reißen.
Der Fahrer als Schwachpunkt der Lieferkette

Genau hier stößt die Logistikbranche auf ein Problem, das sie selbst freimütig einräumt: Der Fahrer ist ein Schwachpunkt der Lieferkette, was unterschiedliche Gründe hat. Aus anderen Ländern angeheuerte Fahrer ersetzen fehlende deutsche Fachkräfte, was zu Verständigungsproblemen führt. Eine geringe Vergütung in vielen Speditionen und Transportunternehmen sorgt für unverhältnismäßig häufigen Personalwechsel. Nicht verstandene Anweisungen aufgrund von Sprachbarrieren erschwert eine durchgängige Kommunikation und den dazu gehörenden Datenaustausch: Hinzu kommen oftmals überfüllte Verkehrswege und Staus, die einer pünktlichen Ankunft der Waren buchstäblich im Wege stehen. Hier reißt die Kette erneut.
Mobile Hilfsmittel
Heute setzen bereits viele Speditionen und Transportunternehmen auf mobile Hilfsmittel: Bordcomputer etwa helfen, Informationen bereitzustellen, durch den Einsatz von Druckern in der Fahrerkabine den Austausch von Dokumenten zu vereinfachen und die Transportplanungen insgesamt flexibler zu gestalten. Spezielle Apps dienen außerdem der Verständigung und können durch Videotelefonie ergänzt werden – etwa dann, wenn am LKW ein Schaden entstanden ist und dieser während eines Telefonats mit einer ausländischen Werkstatt bildlich dokumentiert werden muss. Auch Bildübersetzer per App können LKW-Fahrern verschiedener Nationalitäten die Kommunikation untereinander erleichtern, wenn das gesprochene Wort nicht weiterhelfen kann. Hier werden eingängige Symbole auf dem Smartphone dargestellt, mit denen ein Fahrer sein Anliegen anbringen kann. Über Messenger-Dienste wie WhatsApp halten die Fahrer in Chat-Gruppen nicht nur mit dem Disponenten, sondern auch untereinander Kontakt.

Das neue „Digitale Fahrerbüro“ ist ein weiterer Ansatz der Logistiker, Lücken in der Kommunikation und im Informationsfluss zwischen allen Prozessbeteiligten zu schließen. Dies kann sich zum Beispiel auf Unfälle oder nicht vorhersehbare krankheitsbedingte Ausfälle beziehen. Das Digitale Fahrerbüro nimmt den Fahrer mit Hilfe einer App sozusagen elektronisch an die Hand und führt ihn schrittweise durch die erforderlichen Dokumentationen, die in Echtzeit an die Zentrale übermittelt werden und so allen Prozessbeteiligten zur Verfügung gestellt werden können. Es ist eine Art „Schnittstelle light“, die zwar eine fehlende Schnittstelle nicht ersetzen, aber die Lücke effektiver als mit den alten Methoden überbrücken kann. Solche und andere digitalen Prozesse erleichtern den LKW-Fahrern die Arbeit. Und sind darüber hinaus auch für den Nachwuchs unter den LKW-Fahrern mehr und mehr Attribute für einen attraktiven Arbeitsplatz. Da dieser während seines Arbeitsalltags mit immer höheren Anforderungen wie etwa Staus, Zeitdruck, Verständigungsschwierigkeiten – zu kämpfen hat, können mobile Hilfsmittel auch in diesen Punkten eine echte Erleichterung sein.
Das Mobile Workflow Management vereinfacht wiederum auch die Statuskommunikation zwischen Kraftfahrer und Disponent, wenn Apps die voraussichtliche Ankunftszeit des Fahrers berechnen. Über solche Apps können die notwendigen Arbeitsanweisungen daneben in die benötigte Fremdsprache automatisch übersetzt werden, was die Kommunikation mit ausländischen Kollegen zusätzlich erleichtert, denn die Funktionalität der Apps erlaubt es den Beteiligten Disponenten und Fahrern, jeweils in ihrer Muttersprache kommunizieren zu können. Und: Mit dem Einsatz dieser IT-Technologie lassen sich auch Fehlerquellen und Missverständnisse reduzieren, wenn LKW-Fahrer digital durch ihren Arbeitsalltag geführt werden.
Direkte Kommunikation steigert Effizienz
Diese und andere mobile Lösungen ermöglichen es den Mitarbeitern, in Echtzeit zu kommunizieren und alle zu vernetzen, völlig unabhängig davon, ob sie im Büro Aufträge bearbeiten, verwalten und dokumentieren, ob sie als gewerbliche Mitarbeiter im Fuhrpark arbeiten oder als Fahrer unterwegs sind. Für die Fahrer bringen mobile Apps einen unschätzbaren Vorteil: Die Kommunikation zwischen ihnen und der Disposition entfallen zu großen Teilen. Nachfragen zur genauen Position des Lieferfahrzeugs und der vermutlich verbleibenden Fahrzeit, der voraussichtlichen Ankunft beim Kunden wird mit Hilfe einer Live-Karte und dem Ankunftsmonitor elektronisch erledigt.
Die direkte Kommunikation zwischen Disponenten und Fahrern auf der Grundlage solcher elektronischer Hilfsmittel dient der Effizienzsteigerung bei der gesamten Auftragsabwicklung – etwa durch den Austausch von Daten zur Kontrolle des Auftragsfortschritts. Es gibt eine ganze Reihe solcher entsprechender Kommunikationssysteme, und sie werden ständig weiterentwickelt. Diese docken an bestehende Rechnerstrukturen von Speditionsunternehmen an. Wegen der unterschiedlichen Arbeitsabläufe und Strukturen in Speditionsunternehmen soll eine entsprechende Software dafür sorgen, dass das Kommunikationssystem leicht an unternehmensspezifische Arbeitsabläufe angepasst werden kann.